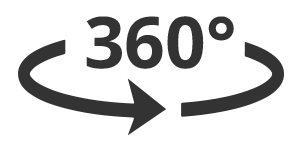Die rund fünfstündige Tour bot eindrucksvolle Einblicke in die klimatologischen, botanischen, faunistischen und geologischen Besonderheiten des markanten Bergmassivs. Entlang der Route wurden die Zusammenhänge zwischen alpinen Lebensräumen und den Auswirkungen der Klimaerwärmung anschaulich erklärt. Dabei wurde deutlich, wie sich jahrhundertealte Pflanzengesellschaften verändern können und welchen Herausforderungen damit Artenvielfalt und Landschaft, aber auch eine zukunftsfähige Landwirtschaft gegenüberstehen.
„Der Ötscher ist aus botanischer Sicht besonders spannend, weil sich hier durch seine klimatologische Sonderstellung zahlreiche endemische Arten erhalten konnten. Ein Beispiel sind die vielen Clusius-Arten wie die Clusius-Primel“, führt Johannes Käfer aus.
Klimaforscher Gerhard Wotawa ergänzt: „Die Alpenregionen haben sich seit der vorindustriellen Zeit bereits um rund drei Grad erwärmt. Aktuell steigt die Temperatur um etwa 0,5 Grad pro Jahrzehnt – in manchen Regionen sogar noch schneller. 0,5 Grad Erwärmung entspricht einer vertikalen Verlagerung der Klimazonen um rund 100 Höhenmeter nach oben und verändert Flora und Landschaft deutlich. Benötigte eine ähnliche Temperaturerhöhung nach der letzten Eiszeit etwa zehntausend Jahre, so dauert es diesmal lediglich dreihundert Jahre, was die Anpassung erschwert.“
Gerald Pfiffinger betont: „Ein Blick in die Kalkvoralpen zeigt, dass alle Gipfel unter der Baumgrenze liegen und damit stark bewaldet sind, während die höheren Gipfel der südlich angrenzenden Kalkhochalpen bislang alle noch waldfrei geblieben sind. Am Ötscher, der bisher stark von bunt blühenden alpinen Rasen geprägt ist, wird sich mit fortschreitendem Klimawandel die Bewaldung bis zum Gipfel ausbreiten und den Charakter der Landschaft verändern.“
Nach einer kurzen Gipfelrast führte der Rückweg zum Ötscher Schutzhaus, wo die TeilnehmerInnen den Tag in geselliger Runde ausklingen ließen. Der Naturpark Ötscher-Tormäuer sieht in solchen Exkursionen einen wichtigen Beitrag, um Bewusstsein für die Veränderungen im alpinen Raum zu schaffen und den Dialog zwischen Forschung, Bevölkerung und Gästen der Region zu fördern.
Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) und die EU (über die Schiene der Ländlichen Entwicklung) fördern diese Klimawanderung im Rahmen des Projekts „Klimaforschungszentrum Ötscher“. Dahinter steckt die Alpenkonvention – ein internationales Übereinkommen zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums.
„Mit attraktiven Formaten wie der Klimawanderung können die Themen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und so soll das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit sensiblen alpinen Lebensräumen gestärkt werden“, so Ewald Galle und Katharina Zwettler, Projektverantwortliche im BMLUK.“